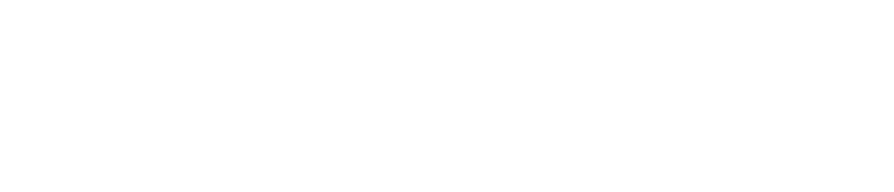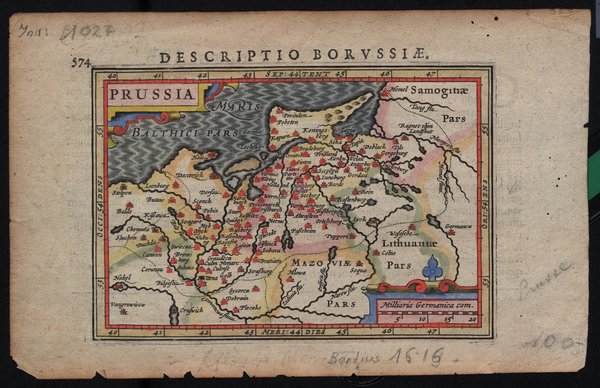
In Europa gibt es ein Land, auf das viele Namen passen.
Deutschen gilt es als „Ostpreußen“, Polen als „Ermland und Masuren“ (Warmia i Mazury), Litauern als „Memelland“ (Klaipėdos kraštas) oder „Klein-Litauen“ (Mažoji Lietuva) und Russen als „Gebiet Kaliningrad“ (Oblast‘ Kaliningrad).
Ist damit aber auch immer dasselbe gemeint? Oder anders gefragt: Fügen sich diese einzelnen Teile überhaupt zu einem gemeinsamem Land, zu einer gemeinsamen Region?
Was ist eine Region?
Regionen haben nach dem heutigen Verständnis keine festen Grenzen mit Stacheldraht oder Zollübergängen, sie haben auch keine eigene Währung und keine eigene Armee – also Dinge, die man im Alltag mit souveränen Staaten in Verbindung bringt. Regionen sind vielmehr Räume, die in erster Linie in der Vorstellungswelt von Menschen existieren. Sie sind in ihrer Reichweite veränderlich und können staatliche Grenzen überschreiten. Ein Mensch kann sich einer Region zugehörig fühlen kann, das hindert ihn aber nicht daran, auch Bindungen an andere Regionen einzugehen: zum Beispiel zu einer Region, in der er früher einmal gelebt hat und wo jetzt vielleicht noch Familie und Freunde leben, zum Beispiel als Besitzer einer Zweitwohnung in einer Ferienregion oder als Fan eines weiter entfernt beheimateten Fußballvereins.
Das „Pruzzenland“ als Erinnerungsregion
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Deutsche, Polen, Russen und Litauer mit dem „Pruzzenland“ sehr schwer getan. Durch neue staatliche Grenzziehungen und dem nahezu vollständigen „Austausch“ der Bevölkerung überwog bei vielen Deutschen ein Gefühl des Verlusts, während sich neu angesiedelte Polen, Litauer und Russen, aber auch Ukrainer und andere Bevölkerungsgruppen „fremd“ vorkamen in einer ungewohnten Umgebung. Am deutlichsten war das im Falle der Sowjetunion: Der nördliche Teil der Region wurde in „Gebiet Kaliningrad“ umbenannt und nichts sollte mehr an eine Vergangenheit erinnern, die zu einem großen Teil von Deutschen geprägt worden war.
Im Laufe der Zeit sind Polen, Litauer und Russen in der Region heimisch geworden, und umgekehrt können Deutsche seit dem Ende des Ostblocks 1989/91 wieder so oft sie wollen in die Region reisen. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, wenn neuerdings Polen und Russen häufiger von „Ostpreußen“ (Prusy Wschodnie bzw. Vostočnaja Prussija) oder Deutsche von „Masuren“ sprechen, auch wenn sie damit durchaus unterschiedliche Vorstellungen von der historischen Vergangenheit, von der Attraktivität der Landschaft oder von prägenden Persönlichkeiten der Region verbinden. Ein sehr gut passender Begriff für diesen Zustand ist der der „geteilten Erinnerunsgregion“. „Geteilt“ kann dabei zweierlei bedeuten: Grenzziehungen, die trennen (vgl. englisch divided) oder gemeinsame Erfahrungen, die verbinden (vgl. englisch shared).
Und warum heißt die Region bei uns eigentlich „Pruzzenland“?
Wie schon deutlich geworden ist, lässt sich ein Name, der allen vier Sichtweisen (der deutschen, der polnischen, der litauischen und der russischen) auch nur annähernd gerecht wird, kaum finden. Wir haben uns daher für einen Namen entschieden, der bewusst sprachlich querliegt, indem er einen Bezug auf die mittlerweile nicht mehr existierenden baltischen Pruzzen bzw. Prußen (Prūsai) anklingen lässt. Das bietet die Chance, Distanz zu wahren gegenüber den teilweise sehr heftigen Auseinandersetzungen um die Frage, wem denn die Region eigentlich gehöre, so wie es im Zeitalter des Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert üblich war.
Was geschah wann im „Pruzzenland“?
Dieser Überblick dient zu einer ersten zeitlichen Orientierung. Der Schwerpunkt liegt auf politischen Ereignissen. Kulturelle und strukturelle Entwicklungen sind vor allem in den zehn Themen angesprochen.
Mittelalter
9. Jhd.
Gründung des Handelsortes Truso im „Pruzzenland“
997
Mission des hl. Adalbert/Wojciech bei den Pruzzen
1226
Einladung des Deutschen Ordens durch den polnischen Fürsten Konrad von Masowien/Mazowiecki, die „Heiden“ im „Pruzzenland“ zu befrieden; den Ordensrittern folgten bäuerliche Siedler aus Mittel- und Westeuropa
1309
Die Marienburg wird Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens
14. Jhd.
Polnischsprachige Siedler aus Masowien und Pomorze kommen in das „Pruzzenland“ und werden später als Masuren bezeichnet
1410
Schlacht von Tannenberg/Grunwald/Žalgiris zwischen dem Deutschen Orden und dem vereinigten polnisch-litauischen Heer, Niederlage des Deutschen Ordens
1440
Gründung des Preußischen Bundes: Zusammenschluss von Adeligen und Städtern des „Pruzzenlandes“ gegen den Deutschen Orden
1454 – 1466
Dreizehnjähriger Krieg
1466
Frieden von Thorn: Das Fürstbistum Ermland und das westliche „Pruzzenland“ um Danzig, Thorn und Elbing kommen an das Königreich Polen (Preußen Königlichen Anteils, Prusy Królewskie), das übrige „Pruzzenland“ verbleibt beim Deutschen Orden, der dem polnischen König Treueeid und Heerfolge leisten muss
Frühe Neuzeit
1525
Annahme der Reformation und Umwandlung des Ordensstaates in das weltliche Herzogtum Preußen unter polnischer Lehnshoheit, Krakauer Huldigung durch Herzog Albrecht von Hohenzollern
1544
Gründung der Universität Königsberg, die in den folgenden Jahrhunderten auch von vielen polnischen und litauischen Studierenden besucht wird
1564/65
Gegenreformation: Der Bischof von Ermland, Stanislaus Hosius, gründet in Braunsberg ein Jesuitenkolleg
1618
Die Kurfürsten von Brandenburg erben die Herzogswürde von Preußen
1618 – 1648
Dreißigjähriger Krieg; die Küstenabschnitte des „Pruzzenlandes“ sind zeitweilig (1629 – 1635) von schwedischen Truppen besetzt
1654 – 1660
Nordischer Krieg zwischen Schweden und Polen-Litauen unter zeitweiliger Beteiligung Brandenburgs, Dänemarks und Siebenbürgens
1657
Vertrag von Wehlau: Der Kurfürst von Brandenburg erreicht, dass das Herzogtum Preußen lehnsunabhängig von Polen wird
1678
Erneuter Einfall schwedischer Truppen ins „Pruzzenland“
1701
In Königsberg Krönung von Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg-Preußen zum König in Preußen, nun als Friedrich I.
Anfang 18. Jhd.
Nach Kriegszerstörungen, Missernten, Pestepidemie und Hungersnot Neubesiedlung insbesondere des nördlichen „Pruzzenlandes“ durch Litauer, Masuren und Salzburger (Glaubensflüchtlinge)
1756 – 1763
Siebenjähriger Krieg, russische Truppen besetzen das „Pruzzenland“
1772
Erste Teilung der Republik Polen-Litauen, das Ermland und das bisher polnische Preußen Königlichen Anteils (Prusy Królewskie) kommen an das Königreich Preußen; die Bezeichnung Ostpreußen bürgert sich für das „Pruzzenland“ ein
1793
Zweite Teilung der Republik Polen-Litauen, Danzig und Thorn kommen an das Königreich Preußen
1795
Dritte Teilung der Republik Polen-Litauen und Ende der staatlichen Unabhängigkeit
Das 19. Jahrhundert
1806/07
Napoleon erobert weite Teile Europas und rückt nach Osten vor: Schlachten von Friedland und Preußisch Eylau, der preußische Königshof flieht nach Memel
1807
Frieden von Tilsit zwischen Napoleon und Zar Alexander I.: Aufteilung der Machtsphären in Europa
1830/31
Novemberaufstand in Polen und Litauen
1848
Revolution in Mitteleuropa
1850er Jahre
Bau der ersten Eisenbahn im „Pruzzenland“, der preußischen „Ostbahn“
1863
Januaraufstand in Polen und Litauen
1877
Erste Wallfahrt nach Dietrichswalde/Gietrzwałd
Das 20. Jahrhundert
1914/15
Erster Weltkrieg: Kämpfe zwischen deutscher und russischer Armee, im „Pruzzenland“ Schlacht bei Tannenberg (August 1914) und Masurische Winterschlacht (Februar 1915)
1918
Ende des Ersten Weltkriegs, Unabhängigkeit Litauens und Polens
1919
Friedensschluss zum Ende des Ersten Weltkriegs, Vertrag von Versailles: die deutsche Provinz Ostpreußen wird aufgrund des polnischen Zugangs zum Meer bei Danzig zur Exklave
1920
Volksabstimmung in den südlichen Landkreisen des „Pruzzenlandes“ über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder Polen; Entscheidung für Deutschland; Memelland unter Verwaltung des Völkerbundes und Schutz französischer Truppen
1923
Memelland wird von Litauen annektiert
1939
22. März: Memelland wird von Deutschland annektiert
1939
1. September: Beginn des Zweiten Weltkriegs durch deutschen Überfall auf Polen
1941
22. Juni: Deutscher Angriff auf die Sowjetunion
1944
Beginn der Flucht der deutschen Bevölkerung aus dem „Pruzzenland“
1945
Vertrag von Jalta zur territorialen Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg: Aufteilung des „Pruzzenlandes“: Süden an Polen, Norden an die Russische SFSR, Memelland an die Litauische SSR; Sturm der Roten Armee auf Königsberg; Potsdamer Abkommen, zu Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung kommen organisierte Umsiedlungen durch Polen und die Sowjetunion hinzu
1950er Jahre
Erste Ausreisewelle von „Spätaussiedlern“ aus Ermland uns Masuren, anfangs in die DDR, später vor allem in die Bundesrepublik
1970
Dezember: Aufstand polnischer Werftarbeiter gegen die kommunistische Herrschaft, vor allem in Gdynia, Szczecin, Gdańsk und Elbląg
1970er Jahre
Beginn der zweiten Ausreisewelle von „Spätaussiedlern“ aus Ermland uns Masuren in die Bundesrepublik
Jüngste Zeit
1989
Politische Wende in Polen
1991
Auflösung der Sowjetunion, faktische Unabhängigkeit Litauens, Gründung der Universität in Klaipėda
1998
Verwaltungsreform in Polen: Entstehung der Wojewodschaft Ermland-Masuren
1999
Gründung der Ermländisch-Masurischen Universität in Olsztyn
2004
EU-Beitritt von Polen und Litauen, das Gebiet Kaliningrad wird russische Exklave in der EU
2005
750-Jahr-Feier von Kaliningrad/Königsberg